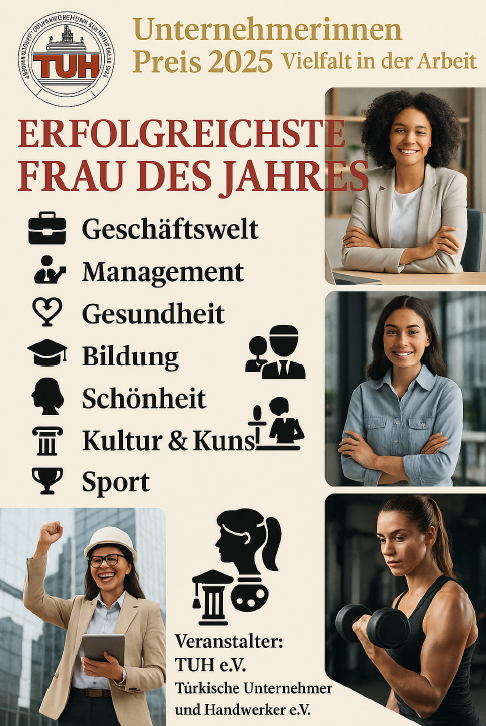Die Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. zu „60 Jahre Anwerbeabkommen“
Die Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V. zu „60 Jahre Anwerbeabkommen“
Aus einem Vertrag wurde eine gemeinsame Geschichte
In Deutschland leben heute etwa drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Einige von ihnen kamen aufgrund des Anwerbeabkommens für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus der Türkei. Es wurde vor genau 60 Jahren, am 30. Oktober 1961, unterzeichnet. Bis heute stellt es einen zentralen Grundpfeiler des Deutsch-Türkischen Verhältnisses dar und symbolisiert immer noch den Startschuss einer Geschichte, deren Ausmaß damals wohl niemand erahnte. Im ersten Jahr kamen gerade einmal 18.000 Frauen und Männer aus der Türkei. Aus heutiger Sicht eine sehr kleine Zahl, viele von ihnen leben auch schon gar nicht mehr. Aber ihnen und ihrer Lebensleistung wird in diesen Tagen eine besondere Aufmerksamkeit zuteil.
Hinter jeder und jedem dieser 18.000 und allen darauf folgenden Gastarbeitern*Gastarbeiterinnen steckt die Geschichte einer mutigen Entscheidung. Wer Dokumente mit entsprechenden Erinnerungen liest, reibt sich doch erstaunt die Augen: Junge Frauen und Männer, die sich voller Neugier und Tatendrang in einen Zug setzten, niemanden der Mitreisenden kannten, um in ein fremdes, tausende Kilometer entferntes Land zu fahren. Und immer das Ziel vor Augen, Geld zu verdienen und die Daheimgebliebenen zu unterstützen. Für sie selbst war damit die Hoffnung auf ein besseres Leben nach ihrer Rückkehr in die Türkei verbunden. Für Deutschland war dieser Einsatz ein wichtiger Beitrag zum Wiederaufbau des Landes nach dem zweiten Weltkrieg. Wir wissen heute, dass sich die Geschichte vieler dieser sogenannten Gastarbeiter*innen über die Jahre völlig veränderte. Aus wenigen Jahren wurde oftmals ein ganzes Leben in Deutschland. Aber immer mit der Vorstellung: Irgendwann gehen wir doch noch zurück. Zuletzt hörte ich dies von einem 80-jährigen. Aber wie kann man gehen, wenn doch die Kinder und Enkel hier leben, hier verwurzelt sind und man nicht allein in der Türkei alt werden möchte. Manche konnten und können es sich leisten, im Alter hin- und her zu fahren – andere nicht.
Ihre ganz persönlichen Geschichten werden zu selten erzählt, zu selten gehört und vor allem zu selten gewürdigt. Das betrifft nicht nur Arbeitnehmer*innen aus der Türkei, sondern auch die vielen weiteren Gruppen von Einwanderinnen und Einwanderern, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte nach Deutschland kamen. Dass insbesondere die Leistung der ersten Generation, die – gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen – hier wirklich besonders hart gearbeitet hat, zu wenig gewürdigt und anerkannt wurde, muss auch bei diesem Jubiläum des Abkommens wieder erwähnt werden.
Dass diesen Menschen, viele von ihnen sind inzwischen bereits verstorben, nie die doppelte Staatsbürgerschaft oder eine politische Teilhabe in unserem Land ermöglicht wurde, tut weh. Über Jahrzehnte wurden immer wiederkehrende Chancen verpasst, das Einwanderungsland Deutschland auch zu einer echten Einwanderungsgesellschaft zu machen, die Teilhabe für die neu dazugewonnenen Bürger*innen ermöglicht. Ein Beispiel, das ich stets wiederhole, bringt diese Versäumnisse zum Ausdruck: Erst 2005, fünfzig Jahre (!) nach dem ersten Anwerbeabkommen Deutschlands, hat sich die Politik durchgerungen, Sprach- und Integrationskurse für Zuwandererinnen und Zuwanderer gesetzlich zu verankern. Gleichzeitig wurde gerade den einst Eingewanderten, die den ganzen Tag gearbeitet haben, vorgeworfen, dass sie nicht genug Deutsch sprechen würden.
Umso wichtiger ist es, bei diesen Versäumnissen, auch im Nachhinein ein Bild zu zeichnen, das deutlich macht: Zuwanderung gehört seit langer Zeit zu unserem Land und die Menschen, die gekommen sind, haben etwas geleistet – für sich selbst und für Deutschland. In der Entwicklung der letzten Jahrzehnte wurden Fehler gemacht und Erfolge erzielt. Es wurden unschöne Debatten geführt, Diskriminierung bekämpft, Ausgrenzung erlebt, Teilhabe ermöglicht. Diese Kultur der Rückschläge und Anerkennung kann in wenigen Jahren in einem Migrationsmuseum in Köln dargestellt werden. Dabei kann es gelingen, die unterschiedlichen Einwanderungswege aus vielen unterschiedlichen Ländern nach Deutschland für alle darzustellen. Dabei können aus Zahlen wieder Menschen, persönliche Schicksale und Lebenswege werden. Und es würde dazu beitragen, dass die individuellen Geschichten der Einwanderung nicht in Vergessenheit geraten.